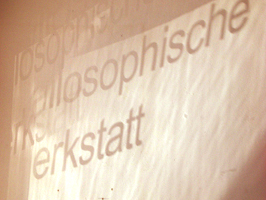Ansatz
In der klassischen Antike war Arbeit für wohlhabende Bürger – und vermutlich auch Bürgerinnen – keine Tugend. Die Arbeit wurde von den Freigelassenen, Sklavinnen und Sklaven verrichtet. Aristoteles bezeichnete diejenigen Beschäftigungen als die niedrigsten, bei denen sich der Körper am meisten abnutzt. (Vgl. Hannah Arendt, Vita Activa, Piper, München 1987, S. 78) Nach Aaron J. Gurjewitsch »ist der antike Bürger ein Krieger, ein Teilnehmer an der Volksversammlung, an sportlichen Wettkämpfen, religiösen Handlungen, er ist ein Besucher von Schauspielen und gastfreundschaftlichen Gelagen – eine Persönlichkeit, die sich außerhalb der Sphäre der materiellen Produktion entwickelt.« (Aaron J. Gurjewitsch, Das Weltbild des mittelalterlichen Menschen, Beck, München 1978, S. 248 ) Voraussetzung für ein Bürgerleben ist Reichtum und nicht physische Arbeit.
Physische Arbeit hatte in der Antike keinen religiös-sittlichen Wert, sie wurde als sinnlos und abstumpfend empfunden. Nur die Untätigkeit war würdevoll und tugendhaft. Der freie Mensch nutzte die Dienste der Sklavinnen und Sklaven, denn sie waren die Werkzeuge, die den Wohlstand garantierten.
Bis zum Mittelalter änderte sich diese Einstellung zur Arbeit nur geringfügig in dem Sinne, dass das hierarchische System differenzierter wurde. Die herrschende Klasse überließ weiterhin den unteren Schichten die Produktionstätigkeit und beschäftigte sich mit ritterlichen Heldentaten und Krieg oder erging sich in Untätigkeit, die ebenfalls zu den edlen Beschäftigungen zählte. Physische Arbeit bedeutete auch im Mittelalter Leiden und Schmerz, das Schicksal der Unfreien und Niedrigen:
»Das Christentum, welches das Prinzip ›wer nicht arbeitet soll auch nicht essen‹ verkündete, brach radikal mit diesen Einstellungen ... In der Arbeit begann man den Normalzustand des Menschen zu sehen. Allerdings wurde dieser Zustand nach der Lehre des Christentums nicht mit der Erschaffung des Menschen zur Notwendigkeit, sondern infolge des Sündenfalls: in der Arbeit sah man auch eine Strafe. Wesentlich ist jedoch, dass die Untätigkeit zu den schwersten Sünden gezählt wurde.« (Aaron J. Gurjewitsch, Das Weltbild des mittelalterlichen Menschen, Beck, München 1978, S. 249)
Die Position der Kirche war in der Frage der moralischen Bewertung von Arbeit zwiespältig, denn Jesus selbst hatte nicht gearbeitet, so auch seine Jünger nicht, denn ihr Lehrer konnte sie ohne jegliche Arbeit ernähren. (Erinnert sei an die Speisung von fünftausend Mann aus fünf Broten, und ein andermal speiste er mit sieben Broten viertausend Mann. Von Frauen und Kindern war dabei keine Rede.) »Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht«, überlieferte Matthäus. (Matthäus 4.4,5) Der Herr sorgte für das Essen seiner Jünger, was ihnen zu tun blieb war, sich um die geistige/irdische Erlösung und um das ewige Leben zu sorgen.
Das kontemplative Leben, die Gerichtetheit zu Gott, stand gegenüber der aktiven Arbeit höher, die Gottes Fluch bedeutete.
»Weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach: Du sollst nicht davon essen –, verflucht sei der Acker um deinetwillen! Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang.« (1. Moses 3.17)
Gottes Fluch lastete nicht auf allen seinen Untertanen, wie Georges Duby nachweist. Im feudalistischen System wurde das Vorherrschen von Ungleichheit als dem Universum immanent angesehen. »Einige befehlen, andere müssen gehorchen.« (Georges Duby, Die drei Ordnungen, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1981, S. 95) Die oratores, der klerikale Stand, und die bellatores, die Krieger, waren die dominierenden Stände, welche die dritte Bevölkerungsschicht, die Freien, Hörigen und Leibeigenen führte.
Noch eine andere Teilung durchzog – und durchzieht heute noch – die Arbeits- und Lebenswelt: Die geschlechtsspezifische Teilung und die unterschiedliche Bewertung von Arbeit.
Wie die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung im Spätmittelalter durchgesetzt wurde, zeigt Wolf-Graaf auf, die diesem Phänomen systematisch auf den Grund ging, und unter anderem darauf hinweist, dass die irrige Vorstellung, Frauen wären im Mittelalter die Sklavinnen der Männer gewesen, nicht den Tatsachen entsprach. Vielmehr haben Frauen, auch wenn sie den Männern rechtlich nicht gleichgestellt waren, in allen Zünften gearbeitet. Sie trieben selbständig Handel und standen auch in der Landwirtschaft selbstverständlich ihre Frau. Das von ihr zusammengestellte Text- und Bildmaterial liefert einen guten Überblick: Frauen als Bänkelsängerinnen, im Silberbergwerk, beim Fischfang, als Braumeisterinnen, Postmeisterinnen, bei der Papierherstellung, beim Flachshecheln, bei der Schafschur, bei der Ernte, ebenso als Spinnerinnen, Metzgerinnen, Bäckerinnen, Schneiderinnen, Schriftgießerinnen, Stecknadelmacherinnen, Heffel- und Schellenmacherinnen, Seidenstickerinnen, Gold-wägerinnen, Schmiedinnen, Äbtissinnen, Gürtlerinnen, Schuh-macherinnen, Baumeisterinnen, Tuchhändlerinnen, Frauen im Groß- und Fernhandel, usw.
»Die praktisch rechtliche Bewegungsfreiheit der Frauen war zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert sehr groß. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass Frauen rechtlich nicht vollständig gleichberechtigt waren. Deutlich ist auch hervorzuheben, dass Frauen im ganzen Mittelalter (und lange danach) keine politischen Rechte besitzen. Diese Tatsache wird bei der Verdrängung der Frauen aus qualifizierten Berufen noch eine verhängnisvolle Rolle spielen.« (Anke Wolf-Graaf, Die verborgene Geschichte der Frauenarbeit, Heyne Verlag, München 1994, S. 39f.)
Die einschneidende Verdrängung der Frauen aus den Zünften begann im 15. und 16. Jahrhundert durch Verschiebung bzw. Veränderung der Absatzmärkte. Wesentliche Faktoren waren die Entdeckung Amerikas, des Seeweges nach Indien, die Eroberung Konstantinopels durch die Türken, die Entfaltung des Verlagswesens*, Abgabenerhöhungen, Handelsbeschränkungen, Erschwerung des Zuganges zu den Zünften, Ausbildungsverbote und diverse frauenfeindliche Schriften wie zum Beispiel jene von Luther, der sich anmaßte, über Frauen in ganz übler Art zu schreiben. (*Das mittelalterliche Verlagswesen ist nicht ident mit den heutigen Buchverlagen, sondern bedeutete, dass die Rohstoffe nicht mehr von den Betrieben selbst gekauft, sondern von Händlern gegen fertige Produkte, zu sehr niedrigen Preisen, zur Verfügung gestellt wurden. Aus den autarken Handwerksbetrieben wurden dadurch Zuarbeitsbetriebe.)
»Denn eyn weibsbild ist nicht geschaffen jungfrau tzu syn, sondern kinder zu tragen ... Ob sie sich aber auch müde und zuletzt (daran) todt tragen, das schadt nicht, laß nur todt tragen, sie sind darum da.« (Anke Wolf-Graaf, Die verborgene Geschichte der Frauenarbeit, Heyne Verlag, München 1994, S. 206)
Luther stellte sich damit auch gegen die weiblichen Lebensgemeinschaften in den Klöstern und Beginenhöfen, die meist sehr erfolgreiche und autonome Zentren wirtschaftlicher Aktivität waren. Zur Verdrängung der Frauen aus den Zünften trugen nicht nur Luthers Attacken und die Frauenfeindlichkeit des katholischen Klerus, sondern auch der Sozialneid der männlichen Zunftmitglieder – der auch in physische Übergriffe ausartete – bei. Nicht nur die physischen und mentalen Übergriffe, sondern auch der Mangel an politischen Rechten machte es möglich, die Frauen aus der Wirtschaft und Öffentlichkeit zu verdrängen:
»… dass sowohl die politische Vertretung der Zünfte (selbst in den reinen Frauenzünften) wie die politische Macht der Räte ausschließlich in den Händen von Männern liegen. So ist es ihnen möglich, Anordnungen und Gesetze zu erlassen, die Frauen immer weiter aus den Handwerken ausschließen. Ihr wirtschaftliches Ansehen und ihr zum Teil hohes Einkommen nützen den Frauen in dieser entscheidenden Situation nichts. Was ihnen fehlt, sind politische Rechte und eine entsprechende Interessenvertretung. Mit der Fürsprache einiger Stadträte zugunsten der Frauen ist es am Ende des 16. Jahrhunderts vorbei. Zu diesem Zeitpunkt werden selbständige Meisterinnen in fast keinem Handwerk mehr erwähnt.« (Anke Wolf-Graaf, Die verborgene Geschichte der Frauenarbeit, Heyne Verlag, München 1994, S. 105)
Das Hinausdrängen der Frauen aus dem Berufsleben, bedingt durch wirtschaftliche und sozialpolitische Veränderungen, war keine einmalige Angelegenheit. Noch deutlich in Erinnerung ist die Situation nach den beiden Weltkriegen, als die Männer von der Front heimkamen und ihr Recht auf Arbeit als Familienernährer geltend machten. Plötzlich waren die von Frauen jahrelang durchgeführten Arbeiten zu schwer, zu gefährlich und der Rolle als Frau und Mutter unwürdig. Um den Schutt der zerbombten Häuser aufzuräumen, waren sie allerdings stark genug, denn dies war unbezahlte Arbeit. Und wo es um unbezahlte Arbeit geht, gibt es auch keine Diskussion darüber, ob die Arbeit vielleicht zu schwer ist oder warum sie überhaupt unbezahlt ist.
Das willkürliche Aussperren der Frauen von den Produktionsstätten und damit auch von der Möglichkeit durch eigene Erwerbsarbeit zu leben, hatte nie etwas mit ihren körperlichen Kräften zu tun. Mann wollte den Markt nicht mit ihnen teilen und damit auch eine eigenständige Reichtumsbildung – in relativen Verhältnissen – und Unabhängigkeit verhindern.
Reichtum wurde generell von der katholischen Kirche moralisch verurteilt. Als Beispiel für ihre Heuchelei im großen Maßstab tat sich Nicolaus Cusanus (1401 – 1464) hervor: Mit 29 Jahren zum Priester geweiht, diente er sich dem Erzbischof von Trier als Sekretär an, nach dem Motto, wenn du etwas werden willst, musst du im Blickfeld eines Mannes stehen, der schon etwas ist. Er bekommt eine pfründereiche Diözese zugewiesen und lernt schnell – wie viele andere Gottesmänner – das Handwerk des Ausbeuters und Pfründevermehrers. Ein paar Jahre später ist er ein reicher Mann. Die Antwort auf die Frage, ob es Gottes Wille sei, wenn sich sein Reichtum türme, fiel ziemlich armselig aus: Cusanus weist darauf hin, dass er einen sehr schlichten Lebenswandel führe und den Armen ohnehin Almosen zukommen ließe. (Vgl. Paul-Heinz Koesters, Deutschland deine Denker, Goldmann Verlag, Hamburg 1980, S. 16)
Bis zu seinem Tode raffte Cusanus zu seinem Vermögen zusätzliche Reichtümer hinzu, so dass sogar seine Mitbrüder, die in dieser Hinsicht keineswegs zimperlich waren, mit dem abstoßenden Charakterzug ihres Bruders nicht mehr zurechtkamen und es daher ablehnten ihn heilig zu sprechen.
Kehren wir wieder zurück zur Arbeit. Christliche Nekropolen dokumentieren in besonderer Deutlichkeit, welche Bedeutung Arbeit für das gemeine Volk in den letzten Jahrhunderten hatte. Aus diversen Sprüchen auf den Grabsteinen lässt sich diese Haltung noch ablesen: Nur Arbeit und Mühsal war ihr Leben, Gott mag ihr nun ein sanftes Ruhekissen geben. Schwere und harte Arbeit war der eigentliche Sinn des Lebens, denn ein akzeptiertes Mitglied der Gesellschaft ist nur, wer hart arbeitet. Das hat sich bis heute nicht geändert, wobei die Definition von harter Arbeit den modernen Berufen angepasst wurde, und somit auch ein Mensch mit Schreibtischberuf, der 18 Stunden am Tag arbeitet, als hart arbeitender Mensch wahrgenommen wird. Aber wirkliche Achtung erfährt nur, wer zusätzlich noch ein Haus baut oder nebenbei im Pfusch dazu verdient.
Die katholische Arbeits-Hypothek, die wir immer noch nicht abbezahlt haben, besteht aus folgenden Denkmustern:
1. Arbeit muss hart sein, sie ist die Strafe Gottes für die Erbsünde.
2. Unterordnung ist gottgegeben.
3. Reichtum ist unmoralisch.
4. Nur wer schwer arbeitet, hat eine Existenzberechtigung und darf auch essen.
Es haben sich zwar in der westlichen Kultur die Arbeitsbedingungen verändert, aber unsere Einstellung zur Arbeit ist noch stark rückwärtsgewandt und eine Mischung aus katholischer und protestantischer Arbeitsmoral. Ebenso sind unsere inneren Wertvorstellungen zum Thema Reichtum, Reichsein und Reichsein-Dürfen religiös geprägt. Nur was materiell sichtbar erschaffen wird, hat Wert, hat Bestand und wird als Erfolgs-Bestätigung gesehen. Dabei arbeiten wir schon lange nicht mehr, um eine Hungersnot abzuwehren, sondern weil wir glauben, uns vor der Gemeinde, vor der Familie, den Bekannten, der Gesellschaft beweisen zu müssen. Das macht Stress und gleichzeitig Druck und Misslaune in der Arbeit. Wir sehen Arbeit nicht als schöpferischen Akt, sondern als Muss und als Leistungsnachweis.
Die Wurzeln des Leistungsdenkens liegen zwar in der katholischen Arbeitsmoral begründet, zur Verfeinerung und Ausreifung jedoch brachten es die von der katholischen Kirche abgespaltenen protestantischen, calvinistischen und puritanischen Religionsgemeinschaften. Vorher gab es noch eine relativ strenge Linie zwischen Arbeit und Privatleben, bei den Calvinisten und Puritanern hingegen griff die Strenge auch ins Privatleben über.
Das Leistungsdenken, die Pflicht zur Rechtschaffenheit, verdanken wir dem Gründer der calvinistischen Ethik, Johannes Calvin (1509 – 1564). Er bekannte sich zur lutherischen Reformationsbewegung, seine Lehre unterschied sich aber von der Lehre Luthers durch eine strengere Glaubens- und Sittenlehre. Auf Ehebruch und Untreue stand die Todesstrafe, Zerstreuungen wie Tanz, Theater, Karten- und Würfelspiele waren untersagt, Privatleben und Kinder-Erziehung streng reglementiert. Von Calvin stammt auch die abgewandelte Prädestinationslehre, die besagt, dass Gott nur wenige Menschen zum Heil bestimme, was sich schon in ihrer irdischen Existenz in Form von wirtschaftlichem Erfolg zeige. Dies führte bei den Calvinisten zu enormen wirtschaftlichen Aktivitäten und gesteigerten persönlichen Anstrengungen, denn jeder wollte von Gott erwählt sein.
Der Calvinismus prägte nicht nur die reformierten Kirchen wie die der Puritaner nachhaltig, sondern auch die wirtschaftliche und soziale Entwicklung Westeuropas und Nordamerikas. Viele Calvinisten und andere reformierte Religionsgemeinschaften wanderten aufgrund kirchlicher und staatlicher Verfolgung um 1600 nach Nordamerika aus und führten damit auch auf diesem Kontinent eine neue Wirtschaftsethik ein, die bis heute Gültigkeit hat.
Der asketische Grundcharakter der Calvinisten verstärkte die Grundhaltung des Alten Testamentes und weitete die Askese und Selbstkontrolle auf das Alltagsleben aus. Jede Handlung, jeder Gedanke sollte einer konstanten Selbstkontrolle unterzogen werden. Sinnlichkeit und Lebensfreude galten als gottunwürdiges Verhalten, die planmäßige Reglementierung des eigenen Lebens als erwünscht. Hatten die asketischen Ideale der Selbstversagung, Unterdrückung des eigenen Willens und das reglementierte Verhalten im katholischen Leben speziell für Ordensleute gegolten, wie zum Beispiel die Regeln des Hl. Benedikt ora et labora (bete und arbeite) – nach genau geregelten Zeiten –, wurden sie im Protestantismus für jeden Einzelnen und jede Einzelne gültig. Weltlichen Genüssen zu entsagen war bei den Protestanten nicht auf die Klosterzellen beschränkt und arbeitsteilig wie in der katholischen Kirche geregelt, sondern für alle Menschen verpflichtend. Mit den Calvinisten wurden das Leben und selbstverständlich auch die Arbeit zum Selbsterziehungs- und Selbstkasteiungsprogramm.
Wie oben schon erwähnt wurden der Calvinismus und der ihm nahe stehende Puritanismus prägend für die wirtschaftliche und soziale Kultur Nordamerikas und Westeuropas.
Bücher füllende Anleitungen mit Tabellen und Weisheiten zum erfolgreichen Benimm, Handlungsmaximen zum Thema Wie werde ich erfolgreich? und Weisheiten zur Lebensplanung sind in der heutigen Wirtschaft ein Muss. Ein Beispiel mag veranschaulichen, woher wir unsere heutige Vorstellung vom Erfolg und zeitgemäßen Zeitmanagement haben. Benjamin Franklin (1706 – 1790), bekannt als Erfinder des Blitzableiters und erfolgreicher amerikanischer Politiker, Naturwissenschafter, Geschäftsmann und Schriftsteller, stellte in seiner Autobiografie einen Tugendkatalog auf, der die Ausbildung der Persönlichkeit zum Ziel hatte und Anleitungen gab, den Lebensstandard zu verbessern. Reichtum war nicht wie beim Adel etwas Ererbtes und Selbstverständliches, es bedurfte für das aufstrebende Bürgertum einer neuen säkularisierten Moral, welche den persönlichen Erfolg legitimierte und als erstrebenswert darstellte.
Franklin entwarf in seiner Autobiographie, Kapitel 8, einen Zeitplan und eine Tugendtabelle, mit deren Hilfe er sein persönliches Tugend- und Zeitmanagement verwaltete und kontrollierte. Im Tugendkatalog vergab er von Sonntag bis Samstag Punkte, falls er eine der Tugenden übertreten hatte. Die Tugenden waren: Mäßigkeit, Schweigsamkeit, Ordnung, Entschlossenheit, Genügsamkeit, Fleiß, Aufrichtigkeit, Gerechtigkeit, Mäßigung, Demut, Reinlichkeit, Gemütsruhe, und Keuschheit. Wurde gegen eine Tugend am Tag zweimal verfehlt, so wurden zwei Punkte eingetragen.
Zusätzlich entwarf er eine Zeittabelle, in der die Stunden des Tages und die planmäßigen Gedankenreflexionen und Aktivitäten verzeichnet wurden. Der Morgen wird mit folgender Frage begonnen: Was werde ich heute Gutes tun? Der Abend wird ebenso mit einer Frage beschlossen: Was habe ich heute Gutes getan? Zwischen 5 und 7 Uhr steht: Steh’ auf, wasche dich, bete zum Allmächtigen! Richte dir das Geschäft des Tages ein und fasse deine Entschlüsse für denselben, setze das jeweilige Studium fort und frühstücke. Von 8 bis 11: Arbeite. Von 12 bis 13: Lies oder prüf deine Geschäftsbücher, iss zu Mittag. Von 14 bis 17: Arbeite. Von 18 bis 21: Bring alle Dinge wieder an ihre Stelle. Nimm das Abendbrot ein. Unterhalte dich mit Musik, Lesen, Gespräch und Zerstreuung. Prüfe den verlebten Tag. (Vgl. Paul-Heinz Koesters, Deutschland deine Denker, Goldmann Verlag, Hamburg 1980, S. 16)
Mit dem modernen Zeit- und Arbeitsmanagement ist es ähnlich wie mit der Psychoanalyse: Beide haben ihre Wurzeln in Europa, wurden nach Amerika exportiert, dort weiterentwickelt und perfektioniert und wieder nach Europa zurückimportiert.
Fast alle Berufstätigen führen heute einen Zeitplaner (Kalender/Timer). Die einen mit mehr, die anderen mit weniger Akribie. Und alle sind sich einig: Ohne Planung kein beruflicher Erfolg. Auch John D. Rockefeller (1839 – 1937), amerikanischer Ölmilliardär und Baptist puritanischer Prägung, legte täglich Rechenschaft ab und kontrollierte seine Wünsche in der Hoffnung, Spontaneität und Unberechenbarkeit aus seinem Leben zu verbannen. (Vgl. Ron Chernow, John D. Rockefeller, Börsenverlag, Rosenheim 2000, S. 44)Genau dagegen verwehren wir uns heute immer mehr.
Die paradoxe Situation besteht für uns darin, dass uns die religiösen Hintergründe kaum oder gar nicht mehr bewusst sind. Es fehlt uns daher der innere Antrieb, der noch mit den religiösen Zielen verbunden war. Daher sind wir heute mehr denn je auf der Suche nach alternativen Motiven und nach Motivation, die uns helfen, Arbeit neu zu begreifen. Arbeit wird von den meisten Menschen als ein lästiges Muss gesehen, als etwas das getan werden muss, um zu überleben, aber nicht als etwas, das mit einem höheren Ziel verbunden ist, auch wenn es religiöser Natur ist.
Die calvinistische Arbeitsmoral war mit einem höheren Ziel verbunden, und zwar zu den von Gott Erwählten zu zählen, denn wen Gott erwählte, dem verlieh er Glück und Wohlstand auf Erden. Die calvinistische Bewegung wurde im Laufe der Jahrhunderte säkularisiert. Daraus entstand die moderne Erfolgsmentalität die besagt: Du hast es selbst in der Hand, erfolgreich auf Erden zu sein, wenn Du zielorientiert und kontrolliert deinen Tagesgeschäften nachgehst. Eine moderne Fassung von Franklins Zeitgerüst und Tugendkalender nennt sich heute zum Beispiel bei Lothar J. Seiwert, dem Zeitmanagementguru unserer Tage, persönliches Erfolgs-Tagebuch und Zeitplanbuch – um noch effektiver zu werden.
Wir wollen heute immer noch Leistung und wirtschaftlichen Erfolg aufweisen. Wir folgen damit dem strengen Tugend- und Zeitkorsett der letzten 450 Jahre, ohne den Sinn einer solchermaßen organisierten Arbeit zu hinterfragen. Wir hinterfragen nicht, sondern wir artikulieren unseren Unmut eher mit dem Ausspruch: Warum muss ICH überhaupt arbeiten um leben zu können? Dahinter verbirgt sich nicht Arbeitsunwilligkeit, sondern eher ein Protest gegen die Arbeitsbedingungen und gegen die alte wie neue Leistungs- und Erfolgsgesellschaft. Erst langsam sickert eine neue Arbeitseinstellung durch, die uns nachdenken lässt, ob es statt Leistungsdenken nicht bessere Orientierungen und Motivationszutaten geben könnte, wie zum Beispiel die Frage nach Wohlbefinden und Sinngebung, das Wissen gebraucht zu werden, die Möglichkeit kreativ und musisch zu sein und zu wissen, dass Arbeit uns ermöglicht, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Arbeit erschöpft nicht nur, sondern sie lässt uns auch lebendig fühlen, sie ermöglicht uns unsere körperlichen, geistigen und emotionalen Kräfte einzusetzen, sie bietet Herausforderung und schafft Zufriedenheit, wenn uns etwas gelingt, sie bietet Erkenntnisgewinn, persönliches Wachstum und Geld. Zwischen Arbeit und Glück existiert ein dickes Band: Glück ist auch etwas, das wir durch sinnvolles Tätigsein erleben, durch Gelingen kommen wir zur Bedeutung von glücken: Glück kommt von Gelingen. Es ist vor allem ein Zustand, in dem wir uns befinden, und nicht eine statistische Erfolgsbilanz.
Zusätzlich zu den oben angeführten Motivationszutaten für eine erfüllende Arbeit gehören auch Freude am Tun, persönliche Visionen und Ziele.
Aus: Klammer/Bauer, Denken entlang des Herzens, BOD 2004 |