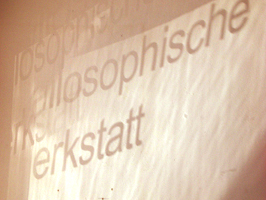Gesellschaft:

|
Firmenphilosophien
Um Fortschrittlichkeit und „Bewusstsein“ zu signalisieren, stellen mittlerweile fast alle mittleren und größeren Unternehmen ihre „Firmenphilosophie“ dar. Warum die Darstellung der eigenen Arbeitsweise und das was Kunden zu erwarten haben, als Philosophie bezeichnet wird ist unklar, zumal es sich bei den meisten „Firmenphilosophien“ um nichts anderes handelt, als um die Darstellung ihrer wirtschaftsorientierten Handlungsweisen bzw. –absichten. Es wird um Kunden geworben, Kunden werden umschmeichelt, ihnen wird versichert, dass sie genau bei dieser Firma auf die richtige Firma getroffen ist, denn die Mitarbeiter sind immer höflich, kompetent, verlässlich, kreativ, stehen Tag und Nacht im Dienst der Kunden, sind leistungsorientiert, vertrauensvoll und jederzeit bereit sich schulen zu lassen, um noch mehr Kompetenz zu liefern. Mit einem Wort alle funktionieren wie auf einem Schnürchen aufgereiht! Die Anforderungen an die MitarbeiterInnen sind selbstredend überdurchschnittlich hoch, genauso wie deren Einsatzbereitschaft.
Summa summarum: Es gilt das Leistungs- und Entwicklungspotential nicht nur optimal zu fördern, sondern das Ganze soll auch noch die Kosten senken. Denn das Ertragspotential kann ja nur durch ein funktionierendes „Human-Resource-Management-System“ ausgeschöpft werden.
Und all das fällt unter Philosophie, der Liebe zur Weisheit! Wer den Begriff Weisheit nie hinterfragt hat, wird ihn zukünftig mit Listigkeit verwechseln: So viel wie möglich, so schnell wie möglich rausquetschen was geht, egal worum es sich handelt: Wirtschaftlich muss es sein. Zuhause ist die Raubbaumentalität dann plötzlich unbeliebt, denn in privaten Beziehungen möchten wir es alle schon etwas „humaner“ haben. Im privaten Kreisen werden dann die Klagen laut: Es ist der Turbokapitalismus, der Konkurrenzdruck, die Arbeitslosigkeit, etc. die uns alle zwingen auf eine Art im Berufsleben zu handeln, die wir persönlich ablehnen.
Was stimmt daran nicht? Man gibt vor ethisch – das heißt für die meisten „philosophisch“ – orientiert zu sein, im Hintergrund aber lauert der Gedanke den größtmöglichen Profit zu machen. Ethik muss sich rechnen!? Oder anders formuliert: Ethik zur Profitmaximierung.
Ethik ist aber kein Begriff der Mathematik, das sollte bekannt sein. Ethik ist der Ausdruck für das sittliche Verhalten von Menschen.
Den Begriff Philosophie als Gaul vor den Leistungs- und Profitkarren zu spannen ist sehr kühn, dass die Zunft selber dazu schweigt ist bedauerlich.
Abgesehen davon, Philosophie für die Gewinnmaximierung zu missbrauchen, ist der Begriff Wirtschaftsethik per se schon irreführend genug.
Ethik und Wirtschaft
Was haben diese hehren Begriffe miteinander zu tun? Wer sich damit befasst, sollte sich zwischendurch immer wieder in Erinnerung rufen, dass es die vielen guten Seelen, die es ehrlich damit meinen, tatsächlich gibt. Unabhängig von der Realität, die, wie wir ja seit dem Konstruktivismus wissen, die Eigenart besitzt, minütlich eine andere sein zu können. Wir sind es die sie herstellen. So simpel soll das Leben sein. Was du denkst wird sein, so nennen es die PraktikerInnen und die AnhängerInnen der neoliberalen Religion: Esoterik.
So wahr diese Aussage – was Du denkst wird sein -, oder Erkenntnis auch sein mag, das Hauptproblem daran ist „das Denken“. Was denken wir, oder anders formuliert, was meinen wir selber zu denken? Wir wiederholen doch ständig nur Phrasen des medialen Palavers das uns permanent gedanklich infiltriert, ohne dass wir es bemerken? Wir klagen, jammern, ärgern uns und suchen die Verantwortlichen für die Misere in der wir uns angeblich befinden immer im Außen. Und wir finden sie auch. An jeder Ecke ist eine/r die/der Schuld zugewiesen werden kann, egal um welche Abweichung es sich handelt. Irgendwer ist immer schuld, nur nicht die Schuldzuweiser selbst. Das Modell ist sehr simpel und deswegen so beliebt, weil es ein entscheidendes Kriterium erfüllt: Die Möglichkeit Eigen- und Mitveranwortung abzulehnen. Oder radikaler formuliert: Die eigene Passivität zu legitimieren.
Alle Menschen sind verwundbar und niemand liebt Maßregelungen oder gar Vorwürfe dieser Art. Dafür haben wir keinen Sensor entwickelt, im Gegenteil unsere Sensoren sind zwar hochaktiv was das Verhalten anderer Menschen betrifft, bei den eigenen Verhaltensmustern sind wir allerdings blind wie Grottenolme. Wir schwätzen kluges Zeug daher, raten anderen dies und jenes zu tun, verurteilen so genannte Missetäter oder stampfen sie in Grund und Boden und vergessen in unserer Selbstgefälligkeit unser eigenes Fehlverhalten. Überfällt uns unvorhergesehen ein reflektiver Gedanke gestehen wir uns kurzfristig ein selbst kein Übermensch zu sein. Und plötzlich strömt Milde aus uns heraus, vor allem Milde uns selbst gegenüber, begründet durch unseren Werdegang. Dann hagelt es nur so von Erkenntnissen worum wir so geworden sind, wie wir sind und selbstverständlich sind auch die Schuldigen mit auf der Liste: Die Eltern, das soziale Milieu, die Gesellschaft, die Politik, die Wirtschaft….
Wir selbst sind es nicht gewesen.
Bis zu einem gewissen Lebensalter darf damit argumentiert werden, ist jedoch eine gewisse Lebensspanne überschritten wird es problematisch sich weiterhin im Kreislauf der Selbstentschuldigung aufzuhalten.
„Das Prinzip von Verantwortung überhaupt – der Beginn der Ethik – wurde noch nicht gezeigt.“ Hans Jonas hat es versucht, und jeder Versuch kann bereits zum Gelingen gezählt werden, denn es sind die Versuche, die uns zum Besseren hinführen, und sei es nur, dass wir das Bessere kurzfristig erfühlen und weitere Anläufe nehmen müssen.
Kleine Heuschrecken
Wir sind uns ja alle einig in der Feststellung: Heutzutage geht es nur mehr um Geld und Profit. Heuschreckenwirtschaft ist das Schlagwort. Was allerdings bei diesen Skandalen völlig unbeachtet bleibt ist, dass der „kleine“ Mann und die „kleine“ Frau selbst davon träumen reich zu werden. Sie finden nur nicht den richtigen Dreh es zu werden, wie die großen Abzocker. Das ist der eigentliche Grund für die Bitterkeit, denn insgeheim werden die Reichen bewundert. Was aber wird bewundert an den Reichen? Die Menge an finanziellen Mitteln die ihnen zur Verfügung stehen, oder die Art und Weise wie sie reich geworden sind?
Das ist bislang ja ziemlich ungeklärt: Einerseits die moralische Verurteilung von Reichtum, denn wir glauben ja, dass ein ehrlicher, das heißt guter Mensch nicht reich werden kann, und andererseits werden Reiche bewundert. Wie nun? Moralische Verurteilung oder Bewunderung?
Genauso widersprüchlich ist auch unser ökonomisches Verhalten. Wir kaufen Produkte von Firmen deren Inhaber wir moralisch verurteilen. Warum kaufen wir Produkte von N. M., I, etc. während wir gleichzeitig deren Firmenpolitik schärfstens verurteilen?
Weil sie gut und günstig sind und uns gefallen, oder weil es keine adäquaten Konkurrenzprodukte gibt? In der Regel gibt es entsprechende Konkurrenzprodukte, doch unser Kaufverhalten ist mehr vom „Haben wollen“ als von konsequentem Handeln definiert, d.h. am Biertisch sind wir Maulhelden, wenn es ums Umsetzen geht sind wir bequeme Pfeifen.
Es ist die Bequemlichkeit, die uns die eigene Moral vergessen lässt.
Unser Konsumverhalten ist leider mit der Produktion von Konsumartikeln sehr eng verbunden. Jede/r weiß das, trotzdem reagieren wir auf die Frage nach unserem Kaufverhalten mit einer Plattitüde: Ich kann mir nichts anderes leisten, der Geldwert sinkt von Jahr zu Jahr. Und seit dem Euro ist überhaupt alles anders.
Der Geldwert hängt aber in starkem Ausmaß auch mit dem Konsumverhalten zusammen und mit der allgemeinen wirtschaftlichen Moral. Wir sind nicht nur KonsumentInnen, wir sind es auch die die Wirtschaft betreiben: Als Angestellte, Arbeiterinnen und UnternehmerInnen. JedeR ist Teil vom Ganzen und somit auch verantwortlich dafür wohin sich die Gesellschaft entwickelt. Grundlage dazu bilden der Wertekatalog und die Debatten darum.
Die Wertedebatte ist immer aktuell, selbst wenn sie sich zyklisch immer wieder als Novum darstellt. Als Auslöser dafür dienen in der Regel Skandale, die wie Flächenbrände wüten, zum Beispiel der Bawag-Skandal oder die Bankenkrise ausgelöst durch die Immobilienblase in den USA. Man/frau ist erschüttert, erbost, frustriert, fühlt sich betrogen und bestätigt, dass „die“ ohne jegliche Moral und Verantwortung tun und lassen können was sie wollen, nämlich: Sich hemmungslos zu bereichern auf Kosten von anderen.
Wozu die Aufregung? Dies entspricht doch nur unserem derzeitigen wirtschaftlichen Kernsatz: Mehr!
Nur: Wie viel mehr vom MEHR brauchen wir?
Für die Einzelnen ist vor allem ein besonderes „Mehr“ spürbar: Mehr Stress, mehr Anpassungs- und Leistungsdruck, Mobbing, Shopping, Müll- und Maschinenberge, Verkehr, Lärm, Staub, Schmutz, Macjobs vor allem für Frauen.
Dieses so genannte Mehr zählt aber auch zu den Werten und Werte werden von UNS Menschen gemacht und auch gelebt, auch wenn wir uns dessen selten bewusst sind, oder besser gesagt unsere Beteiligung daran negieren.
Man könnte jetzt ja behaupten, dass ein gewisses Maß an Bewusstlosigkeit reiner Selbstschutz ist, aber genauso kann behauptet werden, dass die Selbstschutzmaßnahmen nichts anderes als Entwicklungs-Parameter sind. Zuerst kommt das Fressen, dann die Moral, meinte Berthold Brecht, und in gewisser Weise hatte er Recht. Wenn es um die Befriedigung unserer materiellen Bedürfnisse – im Gegensatz zu den ideellen – geht, da lassen wir uns nicht viel Zeit sie zu erledigen, es könnte ja mittendrin im hektischen Tun ein Zweifel auftauchen.
Sammeln
Zweifel sind unangenehm und absolut unmodern. Heute darf es nur mehr Sieger geben, und die kennen und kultivieren keine Zweifel. Sieger bleiben immer Sieger, selten erwischt es einen in dem Ausmaß, dass er zum Sozialhilfeempfänger wird.
Steffi Graf, österreichische Leichathletin kommentierte im ORF 1 den Frauen-Marathon in Athen 2004. Die Methode wie die Läuferinnen das Ziel erreichen können ist, laut Steffi Graf, folgende: „…positiv fokussiert an das Ziel denken und alle Zweifel wegsperren im Kopf.“
Unsere Werte sind materialistisch ausgerichtet. Wer gut im Sammeln ist und das nötige Wissen hat, sich über die anderen Materialmäßig aufzuschwingen, ist ein Vorbild in der Gesellschaft. Die Art des Tuns hat kaum mehr Gewicht. Solange der Profit stimmt, passt es. Wer überleben will, muss sich eben anpassen, sagt man. Die Konkurrenz schläft nicht, tönt es im Echo rund um den Erdball. Wer nicht mitzieht mit den anderen ist so gut wie verloren. Und nachdem es die Anderen auch so denken, müssen wir es halt auch tun. Denkt hier noch jemand?
Der Geist hat sich, weil er sich seiner Nacktheit schämt, aus unserer Kultur zurückgezogen. Das ist jetzt natürlich etwas übertrieben formuliert und könnte milder umschrieben werden. Aber vom Inhalt her ist nicht viel zurückzunehmen. Kommen wir noch mal zum Profit. Das Wort ist französisch und heißt Gewinn, Vorteil. Das Wort Gewinn ist schon biblisch dokumentiert. „Wer unrechtem Gewinn nachgeht, zerstört sein Haus; wer aber Bestechung hasst, der wird leben.“ (Sprüche 15, 27)
Zu diesem Satz kann ich eigentlich nichts sagen, denn weder was den unrechten Gewinn noch die Bestechung betrifft kenne ich mich aus. Ich weiß nur soviel: Kein Mensch will Verlust, alle wollen Gewinn machen, die Kleinen wie die Großen. Verwerflich ist der Wunsch nach Profit allerdings erst ab einer bestimmten Größenordnung, meint frau, meint mann. Warum? Weil ein bisschen Profit moralisch einwandfrei, großer Profit aber moralisch verwerflich ist? Stellt sich die Frage nach ethischem Handeln erst ab einer bestimmten Quantität? Marie Luise von Franz formulierte es so: Ethik ist eine Frage des Fühlens und nicht des Intellekts. Ergänzend kann gesagt werden: Ethik ist keine Mengen – sondern eine Gewissensfrage. Und das Gewissen ist die Waagschale für unsere Empfindungen und Handlungen. „Gewissen impliziert Verantwortung.“
© Irmgard Klammer
|