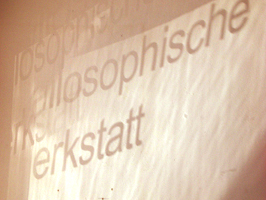Aber es gibt einen Verein. Nennt sich "Verein zur Verlangsamung der Zeit", oder so ähnlich. Sie treten nicht groß in Erscheinung, mensch hört nicht viel von ihnen, möglicherweise warten sie wie die anderen, du und ich, auf revolutionäre Schriften, Methoden und Anleitungen sich dem Zeitterror zu entziehen. Ich hab auch noch keine Methode gefunden. Hie und da nur winzige Zeitlöcher gesehen und wie sie sich sofort wieder schließen, wenn mensch nach ihnen greift. Nicht Hingreifen also ist garantiert der erste Schritt. Laß sie. Tu so, als ob sie gar nicht da wären, aber realisiere die Gelegenheit in sie einzutreten und sich in ihnen einzurichten, und du wirst sehen: die Zeit beginnt sich zu dehnen und zu strecken, aus einer Stunde werden plötzlich zwei, sie verdoppelt sich, obwohl physikalisch nur eine vergangen ist.
Ja, das sind die Zeitlöcher, nicht zu verwechseln mit den Zeit-Toren, denn Zeittore sind durch und durch kein übernatürliches Phänomen wie die Verdoppelung der Stunden in den Zeitlöchern, sondern bedauernswerte Menschen, die jeder Sekunde hinterherhecheln, aus Angst sie könnten gerade jetzt ihre eigene Zukunft versäumen. Das sind die Leute, die ihre Zeit großteils damit verbringen festzustellen, daß sie "keine Zeit haben" für die Dinge, die sie eigentlich gerne tun würden, nur leider fehlt ihnen die Z...!
Da Zeitlöcher so selten und schwer zu handhaben sind, könnte sich mensch dem Phänomen schrittweise annähern. Einer der ersten Schritte wäre, entweder keine Uhren mehr zu tragen, schließlich haben sie auch ein Eigengewicht und oft zählt jeder Deka, oder aber jeder Art von Uhr, wie teuer oder billig sie auch sein mag, ihre tatsächliche Bedeutung zu refundieren: technisches Artefakt zu sein. Keine technische Erfindung hat je einen derartigen Vervielfältigungsboom erlebt wie die Uhren, und keine technische Erfindung hatte je diese Zuwendung erlebt tagtäglich an schätzungsweise 1-2 Milliarden menschlichen Armen herumgetragen zu werden, so als müßten sie permanent gewiegt und verhätschelt werden.
Doch Uhren sind, wie schön und teuer sie auch sein mögen, primär Geräte, Maschinen, die die Zeit anzeigen. Genaugenommen hat eine Uhr nur drei Zeiteinheiten anzuzeigen: Es ist zu früh, es ist zu spät, und - wir liegen richtig in der Zeit. Wofür und für wen?
Es ist bis heute noch nicht bekannt, wann die erste mechanische Uhr (Räderuhr) gebaut wurde. Dante Alighieri (1265-1321) hat in seiner "Divina Commedia" die Räderuhr als Metapher für den Tanz der Seligen verwendet. Folgedessen müssen zu seiner Zeit Räderuhren schon erfunden und im Einsatz gewesen sein. Das erste gesicherte Datum allerdings stammt aus dem Jahre 1335. Zu dieser Zeit soll Guglielmo Zelandino für die Kapelle San Gottardo in Mailand eine mechanische Uhr gebaut haben, einer Zeit also, in der die Päpste nicht in Rom, sondern in Avignon saßen, die Kreuzzüge nicht mehr ins heilige Land geführt wurden, sondern gegen HäretikerInnen, und das Hinausdrängen der Frauen aus den Zünften einsetzte. Zwischen den 13. und 15. Jahrhundert waren Frauen in so gut wie jedem Handwerk, Gewerbe oder Handelsbereich zu finden.
Durch das Anbringen der Uhren auf Kirchtürmen wurden die BürgerInnen sukzessive daran gewöhnt, ihre Tätigkeiten nach der öffentlichen Zeitmessung einzurichten, d.h. ihre Arbeitsprozesse wurden einer Zeitkontrolle unterstellt. Die einst grobe Einteilung Sonnenaufgang, Mittag und Sonnenuntergang, wurde abgelöst durch eine lineare Zeit, geteilt in gleiche Abstände. Es ist nicht schwer nachzuvollziehen, welchen Streß die mittelalterlichen VorfahrInnen beim stündlichen Schlagen der Turmuhren entwickelten. Bis zur ersten Revolte gegen Uhren vergingen allerdings noch Jahrhunderte, voll von weiteren technischen Erfindungen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, dessen größte Erfindung die Idee des Erfindens selbst gewesen ist, richtete sich die Frustration der Arbeiter nicht gegen die Maschinen, sondern gehen die Uhren an den Fabrikstoren.
Sie repräsentierten die moderne Fron.
Bemerkenswert ist, daß vor allem den Benediktinern vorgeworfen wird, als erste auf eine strenge Zeitreglementierung Wert gelegt zu haben, indem sie schon bald, nach dem ihr Orden gegründet worden war (6.Jh.) die Horen (röm. Stunde) einführten, und ihren Tagesablauf danach regelten. Eine irrwitzige Episode über den hl. Benedikt mag veranschaulichen, wie einer, obwohl er sich jahrelang in einer Höhle verkroch, sehr genau wußte, was seine Mitbrüder zu leisten hatten: Als der hl. Benedikt, geboren 480 n. Chr. in Nursia, nach jahrelangem Eremitendasein in einer Höhle, von den Mönchen des Klosters Vicovaro gebeten wurde, die Stelle des verstorbenen Abtes einzunehmen, war eine seiner ersten Handlungen das klösterliche Leben zu straffen. Daraufhin versuchten die Mönche, die an kein geregeltes Leben gewohnt waren, den neuen Abt zu vergiften. Er hatte Glück, der Versuch mißlang, doch das Gift blieb nicht wirkungslos: Benedikt kehrte er in seine Höhle zurück. Inwieweit er seinem eigenen Wahlspruch "ora et labora" nachging ist nicht überliefert. Bekannt ist nur, daß er die ersten Jahre, die er in der unzugänglichen Höhle verbracht hatte, überlebte, indem ein Freund ihn von Zeit zu Zeit Nahrung an einem Seil hinabließ. Ora wird er wohl praktiziert haben, labora allerdings... Aber das ist schließlich auch nur eine Heiligenlegende, und von seinem "ora et labora" ist nur mehr das "labora" übriggeblieben. Und die reglementierte Zeit.
Natürlich, heutzutage ist alles anders. Ganz anders. Wir treffen uns gemütlich zum gemeinsamen Abend in einem Lokal oder privat, plaudern, köcheln, essen, trinken, diskutieren. Dann kommt wieder der Winter, die Tage werden kürzer, die Nächte länger. Ein Tag ist weg wie nichts. Weg wie nichts. Und wer dies feststellt ist mitten drin in der Zeitkatastrophe.
Zuerst kommt der Herbst. Um 16Uhr30 ist es "bereits" dunkel. Dann sinken die Temperaturen, und eines Tages stellt mensch fest: Es ist "schon" Winter. "Bereits" und "schon" sind Wörter, die zur Zeit gehören, anzeigen, daß etwas schon geschehen ist, ohne daß mensch es richtig mitverfolgen konnte. Konsequenterweise müßten sie aus dem Wortschatz gestrichen werden. Aber das wird nicht passieren, dafür haben wir jetzt die neue Rechtschreibreform. Wer hat die eigentlich verlangt? Aber jetzt haben wir sie. Paßt gut zur kybernetischen Lautverschiebung. Kybernetische Lautverschiebung ist kein wissenschaftlicher Begriff, er stammt von mir und besagt folgendes: Je größer unser Maschinenpark wird, und er wächst täglich, desto mehr werden menschliche, tierische und natürliche Töne wie Wind, Regen etc. von artifiziellen Tönen überlagert. Diese künstlichen Töne, verursacht durch Autos, Fabriken, Aufzügen, Telefonen, Fernsehern, Radios, Computergesurre usw. sind die kybernetischen Töne. Je mehr Maschinen, desto größer das Gesurre.
Aber Maschinen steigern doch die Lebensqualität, sagt mann, und entlasten uns von schwerer Arbeit... Aber von welcher Arbeit entlasten uns dann die vielen vielen kleinen Maschinen, genannt Uhren? Da Uhren Zeit messen, werden sie auch Zeitmesser genannt. Was aber hat ein Messer mit Maßeinheit zu tun? Es zerstückelt, was sonst? Zeit-Messer Uhr. Es geht ums Zerteilen, Stück um Stück. Die indogermanische Wortwurzel von Zeit da(i) bedeutet "teilen", "zerschneiden", "zerreißen". Der griechische Stamm daiesthai bedeutet "(ver)teilen" . Also ist die Aufgabe der Uhren die Zeit zu zerteilen, sie in Stücke zu schneiden. Und schon haben wir die Frage, von welcher Art Arbeit Uhren uns entlasten, beantwortet. Mensch stelle sich vor, wenn es keine Uhren gäbe, wie viel Zeit wir damit vertrödeln müßten sie, die Zeit, eigenhändig zu zerteilen, jedes Stück davon zu messen, um halbwegs pünktlich zu sein?
Ach Göttin wie die Zeit dahinrast! Kommt da noch irgendmensch mit? Überschall, Echtzeit-Kommunikation und Lichtgeschwindigkeit. Orgiastische Phantasien gewitzter Geister? Oder einfach nur der fromme Wunsch zu überprüfen ob es wahr ist, daß die Zeit gegen Null geht, bei einer Geschwindigkeit gegen unendlich? Und in dieser Formel liegt nämlich der Hund begraben. Zeit bedeutet Vergänglichkeit und diese wiederum alt werden. Das heißt, je schneller wir leben, desto langsamer werden wir alt. Aber wer will das Leben im Flug verbringen? Wie soll das gehen? Möglicherweise in einer Raumkapsel. Nur will ich nicht in die Unendlichkeit des Weltalls fliegen, sondern hier auf der Erde leben. Angenommen ich flöge in so einem Ding, billiardenteurer Technologie, Richtung Milchstraße und da steht er: Gott der Allmächtige, umgeben von einer Schar Benediktiner. Nicht auszudenken, welche Genugtuung das für all jene wäre, die seit Jahrtausenden zu ihm, Gott Vater, dem Allmächtigen, pünktlich beten. Das feministische Herz würde auf der Stelle aufhören zu schlagen.
Der katholische Hintergrund des Zeitterrors zeigt sich immer noch in der Sitte, den KonfirmandInnen zur Firmung Uhren zu schenken. Früh übt sich in Pünktlichkeit und Tüchtigkeit. Dem hl. Benedikt war Müßiggang (!) der Feind der Seele und es wäre kein Wunder, wenn sich herausstellen würde, daß es die Benediktiner waren, die die mechanische Uhr erfunden haben. In den Augen der Kirche war es aber Gott, der die Zeit verwaltete und so holte sie gegen Wucherer aus und verurteilte das Zinsgeschäft auf Zeit, anstelle der heiligen Jünger, die den "Zeit-Messer" Uhr gegen den Müßiggang auf die Kirchtürme montierten. In den Augen der katholischen Kirche war die Zeit Eigentum Gottes, der sie selbst verteilte. Zinsen, für geborgtes Geld auf Zeit, einzuheben war daher gegen Gott gerichtet und moralisch verwerflich. Gegen die Uhren hatte der Klerus offensichtlich nichts einzuwenden, bewirkten sie doch eine Regelmäßigkeit beim Ausüben der religiösen Pflichten und der profanen, physischen Arbeiten.
In der Antike noch war das noch anders: Die physische Arbeit hatte keinen religiös-sittlichen Wert, sie wurde als sinnlos und abstumpfend empfunden. Nur die Untätigkeit war würdevoll. Der freie Mensch nutzte die Dienste der SklavInnen, denn sie waren die Werkzeuge, die den Wohlstand garantierten.
Bis zum Mittelalter änderte sich diese Einstellung zur Arbeit nur geringfügig in dem Sinne, daß das hierarchische System differenzierter wurde. Die herrschende Klasse überließ weiterhin den unteren Schichten die Produktionstätigkeit und beschäftigte sich mit ritterlichen Heldentaten und Krieg oder erging sich in Untätigkeit, die ebenfalls zu den edlen Beschäftigungen zählte. Physische Arbeit bedeutete im Mittelalter Leiden und Schmerz, das Schicksal der Unfreien und Niedrigen.
Die Position der christlichen Kirche war in der Frage der moralischen Bewertung von Arbeit zwiespältig. Einerseits wurde Adam zur Strafe dafür, daß er im Paradies auf Evas Anraten in den Apfel biß, zur Arbeit verurteilt, andererseits hatte Jesus selbst nicht gearbeitet, so auch seine Jünger nicht, denn ihr Lehrer konnte sie ohne jegliche Arbeit ernähren. "Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht", überlieferte Matthäus, als hätte er das Informationszeitalter vorhergesehen. Denn die Wörter der Medien und das globale Blabla liefern die Verheißungen der Zukunft am laufenden Schirm.
Der Herr sorgte für das Essen seiner Jünger, was ihnen zu tun blieb war sich um die "geistige/irdische Erlösung" und um das "ewige Leben" zu sorgen. Ewiges Leben?
Ewigkeit und Unendlichkeit werden, weil unfühlbar jener Zeitzone zugeordnet, die sich die weit vorausliegende, fernferne Zukunft nennt. Obwohl Zeit nicht fühlbar ist, sind wir doch in der Lage Millionen, Milliarden von Jahren rückwärts und vorwärts zu denken. Die Ewigkeit ist eine religöse Angelegenheit und dem Fühlen zugedacht, die Unendlichkeit eine rein mathematische Größe für das Großhirn und dem Science Fiktion Kult.
Trotzdem ist das Wort Zukunft hoch im Kurs, besonders wenn es gilt die neuen Technologien zu bewerben. Technologie und Zukunft sind schon beinahe Synonyme.
Die Firma Microsoft wirbt für ihre Software sogar auf zwei Zeitebenen: "Schon heute, und morgen erst recht." Beim Lesen dieser Werbung hat mensch fast das Gefühl als intelligenter Mensch angesprochen zu werden. Das macht die Firma ephemer sympathisch, geht sie doch davon aus, daß es Menschen gibt, die nicht nur für die Zukunft leben, sondern in der Gegenwart einkaufen.
Die Firma Techni-Sat hat sogar eine ganze futura-line herausgebracht, da heißt der Astrastar AX1 futura, der Satellitenreceiver Multimedia ADR 1 heißt auch futura und der Sat-Receiver Dresden 1 EPG heißt auch futura.
Versicherungen, Sparguthaben, Zusatzpensionen, Steuerreform, Immobilien, Goldvorräte... alles wird mit dem Wort Zukunft beworben.
Mit einem Wort, wenn du das nicht lernst, kannst, denkst, nicht hast, nicht dabei bist, dann wirst du es in Zukunft aber schwer haben.
Und da soll mensch ein Freude haben, wenn die Zukunft als Drohgebärde über eine/n hängt?
Jede Form der Erpressung operiert mit dem Wort Zukunft. Sie ist der Zeitraum, in dem das Geforderte zu passieren hat, andernfalls es für die Unwilligen schlecht bestellt sein wird.
"Unglücklich ist, wer sich um die Zukunft sorgt", meinte Michel de Montaigne bereits im sechzehnten Jahrhundert, als der Wahnsinn begann die Erde zu umkreisen, die Uhrenproduktion angeworfen wurde, der Weg in den Eden aus den Zifferblättern leuchtete. Endlich konnte die träge Masse diszipliniert werden. Vorerst ging es, vor allem den Zünften an den Kragen, dann entstanden die ersten schönen Fabriken, um die unbändige Arbeitswut der Menschen zu kanalisieren, Konsumartikel für sie herzustellen, etwas, das dem Verbrauch zugeführt werden kann. Schließlich lebt die Konsumgesellschaft davon, daß wir ständig etwas auf- und verbrauchen müssen.
Im Wort brauchen steckt das Wort Brauch und auch Rauch. Ursprünglich bedeutete das Wort brauchen: genießen und sich erfreuen , ein Zustand der ohne Zweifel angenehm wäre, wäre der moderne Kult des Verbrauchens nicht so sehr ans Materielle, dem dahinter Herjagen verbunden. Je schneller desto besser. Nur der Mensch ist im Vergleich zu Maschinen eine enorm träge und sich langsam bewegende Masse, ein Umstand der förmlich nach Kyborgisierung der (menschlichen) Wetware ruft.
Von mir aus kann der "Umstand" rufen so laut er kann, meine Firmungsuhr hab ich ohnehin schon vor Jahrzehnten verloren.